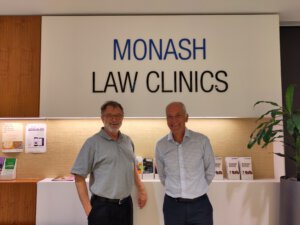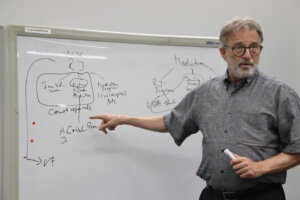Auf der SIMK-Internetseite wurde bereits in verschiedenen Beiträgen auf die fachlichen (Mindest-)Standards der Mediation hingewiesen, die für alle Personen gelten, die als Vermittler:in iSd § 1 Abs. 2 MediationsG ohne Entscheidungskompetenz in der Streitsache zwischen zwei oder mehreren Parteien vermitteln und zwar unabhängig davon ob sie als (Rechts-)Anwälte, (Unternehmens-, Familien-)Berater etc. tätig werden oder wie sie sich (z.B. Moderater, Supervisor et. ) nennen (→sog. funktionaler Mediatorbegriff). Das betrifft insb. die Neutralität und Allparteilichkeit der Vermittler und das Verbot der sog. Vor-, Während- und Nachbefassung. Wer als Mediator iSd § 1 Abs. 2 MediationsG tätig ist, darf in derselben Streitsache weder vor, noch während noch im Anschluß an das Mediationsverfahren als Berater tätig werden.
Nun hat das OLG Celle in seiner Entscheidung vom 26.08.2025 – 2 ORs 9625 die Revision der verurteilten (als Mediator tätigen) Rechtsanwalts gegen das Berufungsurteil des Landgerichts Hannover vom 28. 10.2024 (ursprüngliche Verurteilung AG Springe 18.07.2023) wegen Parteiverrats verworfen und hervorgehoben, dass es „dem Gebot der Unabhängigkeit und Neutralität in besonderem Maße widerspricht, wenn eine Mediatorin bzw. ein Mediator vor, während oder nach einer Mediation in derselben Sache für eine Partei tätig wird.“
Auszug aus der Entscheidung des OLG Celle (26.08.2025 – 2 ORs 9625):
2. Die auf die Rüge der Verletzung materiellen Rechts gebotene umfassende Überprüfung des Urteils hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben:
a) Nach den vom Landgericht rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen nahm der Angeklagte im Oktober 2018 Kontakt zu der Zeugin P. auf. Die schwangere Zeugin hatte wegen einer Ehekrise kurz zuvor die Ehewohnung verlassen müssen und bemühte sich, von ihrem verschiedene Gegenstände zu erlangen, die in der Wohnung verblieben waren. Der Angeklagte stellte sich der Zeugin als Rechtsanwalt und Mediator vor und bot an, zwischen ihr und ihrem Ehemann als „allseitiger“, „unabhängiger“ Mediator einen konstruktiven Dialog zwischen ihr und ihrem Ehemann in die Wege zu leiten. Dabei erklärte er, dass sich der Ehemann um die finanzielle Seite der Mediation kümmern wolle. Die Zeugin P. führte daraufhin ein etwa eineinhalb Stunden dauerndes Gespräch mit dem Angeklagten, in dem sie ihm detailliert ihre Sicht der Eheprobleme und ihren dringenden Bedarf an den Gegenständen schilderte. In der Folgezeit tauschte sich der Angeklagte mit ihr und ihrem Ehemann aus und berichtete ihr schließlich, dass ihr Ehemann „eine Gesamtlösung“ wolle und ein von der Zeugin angestrebter Termin zur Abholung der Gegenstände nicht stattfinde. Eine Einigung kam nicht zustande. Im späteren Scheidungsverfahren zeigte der Angeklagte im Januar 2021 gegenüber dem Amtsgericht Wolfsburg an, dass er die rechtlichen Interessen des Zeugen P. vertrete, versicherte seine anwaltliche Bevollmächtigung und beantragte Akteneinsicht. Nach einer Rüge durch die Rechtsanwaltskammer legte er sein Mandat nieder.
b) Das Landgericht hat es zu Recht als pflichtwidrig im Sinne des § 356 StGB gewertet, dass der Angeklagte nach dem Scheitern der Mediation den Ehemann der Zeugin P. anwaltlich vertreten hat. Diese Bewertung entspricht der ausdrücklichen Tätigkeitsbeschränkung aus § 3 Abs. 2 Satz 2 MediationsG, der bereits vor Inkrafttreten des Mediationsgesetzes ergangenen Rechtsprechung und der ganz überwiegenden straf- und berufsrechtlichen Literatur (OLG Karlsruhe, Urteil vom 26. April 2001 – 2 U 1/00 –, Rn. 2, juris; OLG Karlsruhe, Urteil vom 19. September 2002 – 3 Ss 143/01 –, Rn. 19, juris [mit Abgrenzung zur erfolgreichen einvernehmlichen Scheidung]; Wolter / Hoyer, SK-StGB – Kommentar, 10. Auflage 2023, § 356 StGB, Rn. 40; BeckOK StGB/Heuchemer/von Heintschel-Heinegg, 66. Ed. 1.8.2025, StGB § 356 Rn. 30; Lackner/Kühl/Heger/Heger, 30. Aufl. 2023, StGB § 356 Rn. 7a; MüKoStGB/Schreiner, 4. Aufl. 2022, StGB § 356 Rn. 69; Gillmeister in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Auflage, § 356 StGB, Rn. 36; TK-StGB/Weißer/Bosch, 31. Aufl. 2025, StGB § 356 Rn. 22; Matt/Renzikowski/Matt, 2. Aufl. 2020, StGB § 356 Rn. 36; Weyland/Bauckmann, 11. Aufl. 2024, BRAO § 43a Rn. 70; BeckRA-HdB/Hamm, 12. Aufl. 2022, § 53. Rn. 47; Henssler/Prütting/Henssler, 6. Aufl. 2024, BRAO § 43a Rn. 251). Der Senat schließt sich dem an und teilt die Auffassung der Gesetzesbegründung zu § MediationsG, dass es dem Gebot der Unabhängigkeit und Neutralität in besonderem Maße widerspricht, wenn eine Mediatorin bzw. ein Mediator vor, während oder nach einer Mediation in derselben Sache für eine Partei tätig wird (BT-Drs. 17/5335, S. 16).
Quelle: OLG Celle Beschl. v. 26.08.2025, Az.: 2 ORs 96/25
(NI-Voris; dejureorg mwNw)